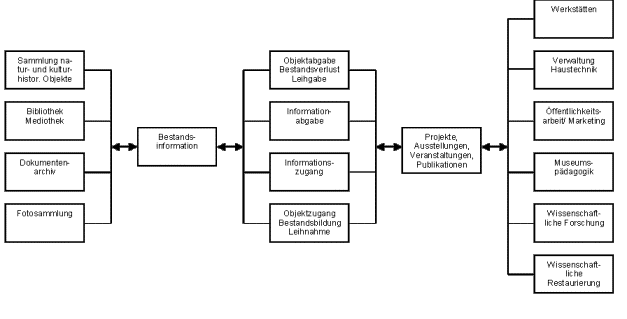
Abb.2-x: Quelle: Publikation deutscher Museumsbund
CIT Spezifikation v0.9 - es/vgt idf 260901
2.1.1. CIT-Archiv Anforderungen
An der Dombauhütte St. Stephan werden alle Dokumente seit 1945 zum und über
den Dom zu St. Stephan archiviert und verwaltet. Das Archiv wird von einem eigenen
Archivar betreut. Der Verleih von Archivalien erfolgt in Abstimmung mit dem
Dombaumeister.
Zu den Archivalien zählen Pläne, Fotos, Mikrofiches, Glasplatten und Dokumente.
Im Rahmen des EU-Projektes Cathedral.IT soll neben einem Routine-System für die Alltagsarbeit ein System zur Digitalisierung und Archivierung dieser Archivalien (digitale Kopien) konzipiert und realisiert werden (vgl. Kapitel 1.4. Nutzungs- und Funktionskonzept).
Das Archiv-System soll als wachsendes System die Verwaltung der Archivalien unterstützen, in zeitgemäß verbesserter Form den Eintrag von Daten und den Zugang zu den Datenbeständen ermöglichen. Das Archiv-System wird auf einer Wissensdatenbank aufbauen und soll allmählich zu einer umfassenden, objektbezogenen Wissensdatenbank werden.
Ziel ist die Schaffung einer hybriden, digitalen Verwaltungslösung für die Archivalien um:
• Originale vor Abnutzung und Verlust zu schützen;
• Originale zu konservieren (Digitalisierung)
und damit
Veränderungen an den Originalen über die Zeit zu korrelieren zu können;
• Die Zugänglichkeit zu den Dokumenten (digitalen
Kopien) einfacher zu machen (weltweiter Zugriff).
2.1.2. Cathedral.IT-Archiv:
Datenbestand / Datentypen
Der derzeitige Datenbestand an der Dombauhütte umfaßt ca. 22.400 Archivalien. Weiters gibt es spezielle Informationen, die zum Erhalt des Domes gehören:
| Datentypen | Kurzbeschreibung |
| Archivalien | Fotos, Mikrofisches, Dokumente, Pläne, ... |
| Bautagebücher | |
| Kontaktpersonen | Professionisten, historische Persönlichkeiten, ... |
| Multimedia-Datenträger | Videos, Tonträger, digitale Movies, ... |
| Termine | |
| Geometrieinformation | |
| Berichte | Sammelmappen, ... |
| Präsentationen | z.B. Powerpointpräsentationen, ... |
| Kartierungsinformation | Restaurationsberichte, Kartierungsdaten (BPDM-System), ... |
| andere |
Tab. 2-1: Cathedral.IT-Archiv: Datentypen
Die nachfolgende Aufstellung enthält eine Aufgliederung der Archivalien und ein Grobkalkulation der „digitalen Erfordernisse“:
|
Übersicht Archivbestände |
Anzahl |
Maße |
Auflösung |
Datenmenge (ca. MB) |
||||
|
l |
b |
dpi |
bit |
|||||
|
Papierpläne |
1.043 |
90 |
120 |
300 |
8 |
155,52 |
162.207,36 |
|
|
Microfiche |
613 |
4 |
3 |
1.200 |
8 |
2,76 |
1.694,82 |
|
|
Photos Wiederaufbau |
509 |
10 |
15 |
600 |
8 |
8,64 |
4.397,76 |
|
|
Photoordner |
69 |
20.700 |
10 |
15 |
300 |
24 |
6,48 |
134.136,00 |
|
Pläne Bildmessung |
49 |
90 |
160 |
300 |
1 |
25,92 |
1.270,08 |
|
|
Photogrammetriepläne Linsinger |
24 |
60 |
80 |
600 |
1 |
34,56 |
829,44 |
|
|
Bestand ohne Microfichedoubletten |
22.400 |
Objekte |
304.535,46 |
|||||
Tab. 2-2: Cathedral.IT-Archiv: Archivalien/Übersicht
Der derzeitige Archivbestand (Hochrechnung ohne evtl. Komprimierung) ergibt - bei ca 22.000 Objekten im Bestand – ca. 304 GB:
Zusätzlich ist noch mit – je nach Ausbauzustand – 500 - 3000 Mittelformatdias zu rechnen.
2.1.3. CIT-Archiv: Datenfeldkatalog, Workflow
DatenfeldkatalogDie unter 2.1 angeführten Datenbestände lassen sich in folgende Objekttypen untergliedern:
| Objekttyp |
Beschreibung |
|
Archivalien |
Pläne, Zeichnungen, Bildmeßpläne, ... |
|
Personen |
historische Persönlichkeiten, Fachexperten, Rechteinhaber, aktuelle Personen |
|
Bilder |
Photos, Microfiche, Gläser, digitale Aufnahmen, ... |
|
Ereignisse |
Kartierungslose |
|
Dokumente |
wissenschaftliche Arbeiten |
|
Akten |
Schriftverkehr, Rechnungen, ... |
|
AV-Medien |
Tondokumente, Videos |
|
Spezialobjekte |
Kartierungscontainer |
Tab. 2-3: Cathedral.IT-Archiv: Objekttypen
Die Objekte werden zur Erfassung mit folgenden Bezeichnungen festgelegt:
|
Objekt |
Attribut |
Begriff / Beziehung |
|
Bezeichnung |
Ein-Wort-Beschreibung |
Datei-Eigenschaft |
|
Benennung |
File-System-Ebene |
Datei-Name |
|
Beschreibung |
Text, Länge, Typ, Datum |
Metainformation |
|
Relationen |
zwischen welchen Objekten? |
Relation |
|
Rechte |
Urheberrechte, Vervielfältigungsrechte |
Rolle |
|
Datum |
Erstellung / Modifikation |
Datei-Eigenschaft |
|
ID |
Objekt-ID |
eindeutige Objekt-ID |
|
Ort |
physikalische Lage des Objekts |
(siehe Kap. Barcode) |
Tab. 2-4: Cathedral.IT-Archiv: Archivalien/Übersicht
Datenfeldkatalog einfügen!!!
Die nachstehende Abbildung zeigt die Zusammenhänge der einzelnen Objekte und Einsatzbereiche im Sinne eines „Workflows“.
Workflow
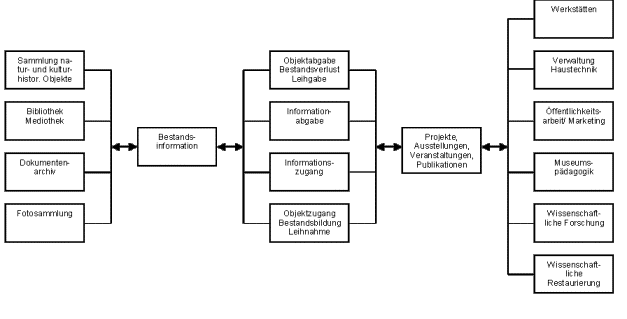
Abb.2-x: Quelle: Publikation deutscher Museumsbund
2.1.4. CIT-Archiv: Gliederungsstruktur (=Zerfallstruktur) / Glossar
Eine Zerfallstrukturgliederung für den Dom wird im Rahmen des CIT-Projektes erstellt. Die Struktur wird im BPDM-System festgelegt und für die einzelnen Kartierungen in das Kartierungserfassungssystem übernommen. Die Gliederungsstruktur bildet ein gemeinsames Orientierungssystem für alle CIT-Komponenten. Die nach der Kartierung in das BPDM-System rückgeführten Daten und nach Projektabschluß ins CIT-Archiv übernommenen Daten können dadurch eindeutig verortet werden. Die in der Datenbank abgelegten Objekte werden über Relationen mit der Gliederungsstruktur verknüpt. Somit ist es möglich, alle relevanten Informationen zu einem bestimmten Gebäudeteil am Dom schnell aufzufinden.
Die Gliederungsstruktur zieht sich als "roter Faden" durch alle Bereiche des Sytems - jeder Bauteil erhält einen Code, der im 3D-Modell, am Bauwerk, in den Plänen und in der Datenbank ident ist - damit ist eine durchgängige Schnittstelle sichergestellt.
|
Gliederungsstruktur am Gebäude
und 3D-Baukörper
|
Gliederungsstruktur in den Plänen
und Arbeitsunterlagen
|
Gliederungsstruktur in der Datenbank
|
 |
|
|
Gliederungsstruktur
Grafik
Glossare können durch die beteiligten Nutzergruppen des CIT-Systems erstellt
werden.
2.1.5. CIT-Archiv: Nutzer / Zielgruppen / Rollen
Das CIT-Archiv bietet den Zugang zu den eingepflegten Materialien lokal oder über das Internet an:
Der Internet-Zugang erfordert lediglich einen Internet-Browser oder gegebenenfalls einen Acrobat-Reader für PDF-Dokumente.
Folgende Zielgruppen des Teilsystems Archiv können differenziert werden:
|
Zielgruppen |
Nutzer/Kunden |
Tätigkeiten/Nutzungen |
|
Dombauhütte / Dombau-sekretariat |
Dombaumeister |
Verwaltung, Recherche, Facility Management, |
|
Sachbearbeiter CAD |
Verwaltung, Recherche, Facility-Management,
Einpflegen von Inhalten; |
|
|
Restauratoren |
Facility-Management, Einpflegen von
Inhalten, |
|
|
Archivar |
Archivierung, Verwaltung, Recherche, Einpflegen von Inhalten |
|
|
Wissenschaft |
Archäologen, Geologen, Kunsthistoriker,
Biologen, Baukünstler, Historiker, universitäre Einrichtungen, |
Recherche, Einpflegen von Inhalten, Suche und Abruf von Bestandsdaten |
|
Medien |
Recherche, Information |
|
|
Tourismus |
Information |
|
|
IT-Experten |
Systembetreung, Datenmanagement, Updates |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Zielgruppen – Nutzer/Kunden – Tätigkeiten/Nutzungen
Im wesentlichen kann hinsichtlich der Zielgruppen für das CIT-Archiv-System zwischen einer Hauptgruppe an Nutzern/Kunden und benachbarten Zielgruppen unterschieden werden:
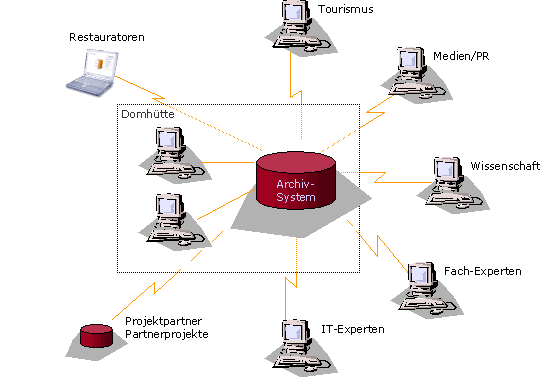
Abb. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Haupt- und Nebennutzer des CIT-Archivsystems
Hauptnutzer ist das Dombausekretariat und die Dombauhütte.
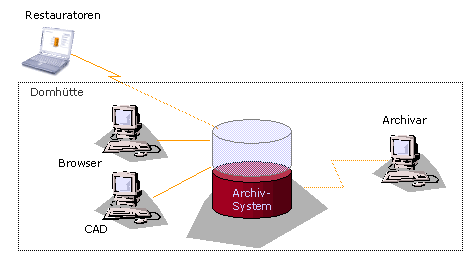
Die Nutzergruppen werden entsprechend den Anforderungen an das Archiv-System angebunden. Für den Zugriff auf die Datenbestände werden Rollen definiert.
Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Hauptgruppe der Nutzer sowie die weiteren Zielgruppen der Nutzer/Kunden.
Hauptgruppe
|
Gruppe/Person |
Zugriff auf: |
Rolle |
Anbindung |
|
Dombaumeister |
gesamter Bestand |
Leiter |
Intranet und |
|
Dombausekretariat |
arbeitsbezogene |
Sekretariat |
Intranet und |
|
Archivar |
arbeitsbezogene |
Archivar |
Intranet und |
|
Restauratoren |
arbeitsbezogene |
Bearbeiter |
Intranet und |
|
CAD-Bearbeiter |
arbeitsbezogene |
Bearbeiter |
Intranet und |
|
System-Administratoren |
systemadministrative |
Systemadministrator |
Intranet |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Hauptgruppe Nutzer
Weitere Zielgruppen
|
Gruppe/Person |
Zugriff auf |
Rolle |
Anbindung |
|
Wissenschaft |
arbeitsbezogene |
Experte |
Extranet und |
|
Medien |
freigegebene |
Medien |
Internet |
|
Tourismus |
freigegebene |
Tourist |
Internet |
|
Interessierter, |
freigegebene |
Internet |
Internet |
|
IT-Experten |
freigegebene |
Medien, Tourist, Internet |
Extranet oder |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Weitere Zielgruppen
2.1.6. CIT-Archiv: funktionelle Konzeption und Einbindung
Das Archiv-System ist gekoppelt mit einem Bestands- und Projekt-Daten-Management-System (BPDM-System) - für die CAD/GIS-Datenbearbeitung sowie die Schadenskartierung, einem Routinesystem zur Verwaltung täglicher Arbeiten:
Sämtliche Daten des Alltagsystems können/sollen selektiv in das Archiv übergeführt werden (z.B. Tagebücher). Die Überführung erfolgt nach Abschluß eines Projektes zur Schadenskartierung (Kartierungslos) durch sorgfältige Auswahl der erfaßten Dokumente.
Das Archiv-System umfaßt daher einerseits:
1) Archivbereich: alle oben angeführten Bestanddaten seit 1945, (welche zu digitalisieren sind) sowie die neu erfaßten oder zu erfassenden Materialien die zum Bestand des Doms gehören.
2) Bearbeitungsbereich: Projektverfolgung bestehender Projekte und Schadenskartierung – Schwerpunkt: CAD/GIS-Lösung; daran angehängt sind diverse andere Daten (Berichte, aktuelle Fotos, Rechnungen, Adressen, Gutachten, Pläne, Videos); sobald ein Projekt (ein Bauabschnitt) abgeschlossen ist, wird dieses(r) in das Archiv gespeichert – bis dahin erfolgt die Bearbeitung und Vorhaltung in einer getrennten Datenbank unter dem BPDM-System.Das Alltagsystem (BPDM-System) unterscheidet sequentielle und parallele Arbeitsabläufe:
Die sequentiellen Abläufe in einem Projekt werden in Phasen und Versionen organisiert, die parallelen Abläufe als Varianten und Alternativen.
Zudem wird im Alltagsystem zwischen temporären und kontinuierlichen Projekten unterschieden; temporäre Projekte werden nach Abschluß in kontiuierliche Projekte übergeführt und dabei ins Archiv-System übernommen.
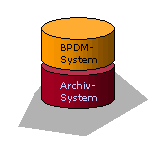
Abb. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: BPDM-System und Archiv-System
2.1.7. CIT-Archiv: Funktionsanforderungen / Voraussetzungen
Ziele sind einerseits die vereinfachte Recherchemöglichkeit und Auswertung – auch im Hinblick auf Publikation (Datenexport), die einfache Ausdruck/Ausgabemöglichkeit (z.B. soll die Erstellung eines Vortrages auf Powerpoint aus den div. Archivbildern und Datenauswertungen komfortabel möglich sein) und der Zugang via Internet, andererseits die Erfassung und Dokumentation der aktuellen Arbeiten (via CAD/GIS samt Attributzuordnung etc.) mit bidirektionaler Anbindung an die Recherchemöglichkeiten sowie der Bereich eines „Wartungsplanes“ (Daten mit „Ablaufdatum“ – z.B. die Maßnahme xy hat in 10 Jahren überprüft zu werden, Zuordnung „10Jahre Gültigkeit, dann Wiedervorlage“).
Grundlegend ist zu beachten, daß der Serviceaufwand der Datenbank und der Webanbindung geringstmöglich zu halten ist, die Eingaben und Abfragen sollen nach Profilschlüsseln (Dombaumeister, Restaurator, Steinmetz, Archivar, Wissenschaftler, Tourist) erfolgen und müssen ohne besondere Fachkenntnis möglich sein.
Im einzelnen gelten folgende Zielsetzungen für die Ausbildung des Archiv-Systems:
|
Zielsetzungen |
Beschreibung |
|
Schutz des Originals |
Schutz der Archivalien vor Abnutzung, Beschädigungen oder Verlusten; Erhaltung des Originalzustandes eines Objekts bzw. der digitalen Kopie (keine Manipulation am Original) |
|
Update der Archiv-Daten |
kontinuierliches Update der Archiv-Daten'> (Aktualisierung, automatischer Datenimport) |
|
Einfache Handhabbarkeit |
einfache Eingabemöglichkeiten von Memos, Berichten, Bildern, Plänen, Scans, etc. (es soll keine eigene „EDV-Gruppe“ zur Wartung, Eingabe und Benutzung geben) |
|
Zielgruppen |
Das System soll durch digitale Vernetzung mehreren Zielgruppen zur Verfügung stehen |
|
Systemoffenheit Datenoffenheit |
|
|
Systemoptimierung |
nachträgliche Adaptierungsmöglichkeiten |
|
Datenbank |
Quasi-Datenbank-Standards |
|
Systemoptionen / |
Das System muß Einstellungsmöglichkeiten für Workflowoptimierungen bieten, wie z.B. indiviuelle Masken, vordefinierbare Werte für Abfragefelder, etc. |
|
Schnittstellen zu BPDM |
Der Daten-Export bzw. –Import in das BPDM-System-Daten muß integriert sein. |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Zielsetzungen / Systemanforderungen
Mit dem Archiv-System soll ein Werkzeug geschaffen werden, das einfach und zuverlässig funktioniert und hinsichtlich der Erhaltung und Folgekosten schlank bleibt.
2.1.8. CIT-Archiv: Hybride - Lösung / BarCodes
Studien ergeben, daß die Lebensdauer der neuen Medien stets kürzer wird. Dies verlangt einen unentwegten Kopierprozeß der digitalen Daten auf neue Datenträger. Zum anderen ist eine exakte Digitalisierung mit sehr hohen Datenmengen verbunden, weswegen die Archivalien nur auf eine erforderliche und handhabbare Auflösung gescannt werden. Zu späteren Zeiten kann jedoch die Forderung nach höherer Auflösung laut werden, was ein Nachscannen der Archivalien erfordert. Positiver Nebeneffekt des Nachscannens ist, daß die unterschiedlichen (zeitversetzen) Scans auf Alterung der Archivalie analysiert werden können.
Hybride Lösung
Ein hybride Lösung zur Verwaltung der physischen Archivalien kombiniert mit den digitalen Kopien ist aufgrund der anfallenden Datenmengen bei der Digitalisierung, den technologischen Fortschritten im Bereich der Digitialisierungen sowie durch die beschränkte Haltbarkeit der Medien anzustreben. Dabei wird die Verwaltung auf digitaler Ebene durchgeführt, die Archivalien werden allerdings sowohl digital (eingescannt) wie auch physisch reproduziert (Microfiches).
Anmerkung betr. Mikrofiches
Das Digitalisieren von Mikrofiches produziert hohe Datenmengen - gefordert sind daher schlanke digitale Versionen zur Verwendung im Internetzugang und Duplikate von Mikrofiches für die langfristige Konservierung.| Ort | Bezeichnung | Schlüssel |
| Raum | Dombauarchiv | |
| Schrank / Regal | ||
| Ebene | ||
| Ordner | ||
| Gliederung |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Beschreibung des physischen Orientierungssystems
Details einfügen
Archivalien sind Arbeitsgrundlage an der Dombauhütte. Mit Barcodes oder ID’s versehene Dokumente sollen mit möglichst geringen Aufwand wieder in das Archiv rückgestellt werden können. Die Verwendung von Barcodes erfordert eine entsprechende Infrastruktur zum Erfassen und Erstellen von Barcodes. Dies ist bei ID-Labels nicht erforderlich.2.1.9. CIT-Archiv: Schnittstellen und Formate
Die Archivalien werden im Archiv-System in folgenden Formaten abgelegt:
| Objekttyp |
Beschreibung |
AblageFormat |
|
Archivalien |
Pläne, Zeichnungen, Bildmeßpläne |
PDF, DWG |
|
Personen |
historische Persönlichkeiten, Fachexperten, Rechteinhaber (Verwaltungsrechte), aktuelle Personen |
Text |
|
Bilder |
Photos, Microfiche, Gläser, digitale Aufnahmen |
JPG, GIF, TIFF |
|
Ereignisse |
Kartierungslose |
PDF; Text, JPG |
|
Dokumente |
wissenschlaftliche Arbeiten |
Text, PDF |
|
Akten |
Schriftverkehr, Rechnungen |
Text, PDF, JPG, GIF |
|
AV-Medien |
Tondokumente, Videos |
RealVideo, Quicktime, WindowsMedia |
|
Spezialobjekte |
Kartierungskontainer |
VRML, |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Archivalien: Objekttypen und Formate
XML soll die Schnittstelle zur Datenübergabe zwischen Datenbank-System bilden. Dies betrifft die Anleihe bzw. den Verleih von Archivalien, wie auch die Übergabe der Dateninhalte an andere Verwaltungswerkzeuge und Webauftritte.Die Schnittstelle zum BPDM-System ist wie folgt zu bilden:1. Import von Kariterungsdaten aus dem BPDM-System in das Archiv:
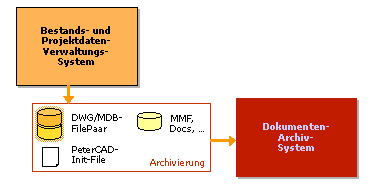
Kartierungslose müssen nach Abschluß des Projekts aus dem BPDM-System in einem
„Kontainer“ an das Archiv-System als File-Paare (AutoCAD-DrawingFile DWG, Microsoft-Access-File
MDB) übergeben werden. Zusätzlich sind im „Kontainer“ auch andere Dokumente
wie Ton-Files, Dokumente und Bilder enthalten. Der „Kontainer“ muß auch nach
50 Jahren geöffnet werden können.
2. Import von „applikationsunabhängigen Kartierungsinformationen und Analsysedaten
in das Archiv:
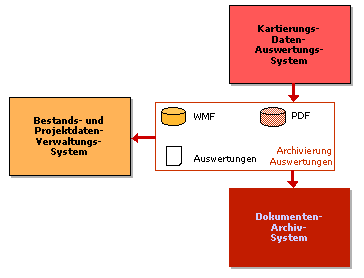
In diesem Prozeß werden webfähige, aufbereite und ausgewählte Dokumente
aus der Auswertung der Kartierung ins Archiv übernommen (Text, Bilder in JPG,
GIF, PDF). Die Information sind mit den „Kontainer“-Informationen aus dem BPDM-System
zu verknüpfen.
3. Export von Archiv-Daten
der Karitierung aus dem Archiv in das BPDM-System
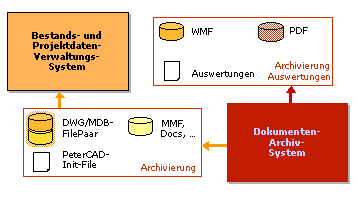
Zur Kartierungsvorbereitung müssen relevante Bildmaterialien und bereits durchgeführte
Kartierungsmaterialien in das BPDM-System rückgeführt werden können. Dabei sind
die Kontainer aus dem Archiv zu exportieren. Die Suche nach den Kontainern muß
über die verknüpften Kartierungsinformationen erfolgen.
Abb. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Schnittstelle BPDM-System
2.1.10. CIT-Archiv: Erfassungsprozeß
Die Erfassung bzw. Digitalisierung der Archivalien erfolgt nach Installation und Inbetriebnahme des CIT-Archiv-Systems.
Der Scan-Prozeß kann folgendermaßen durchgeführt werden:|
Schritt |
Funktion |
Beschreibung |
|
1 |
Erstellung von Objekt-IDs |
Die zu digitalisierenden Archivalien werden vor dem Scanvorgang bereits in der Datenbank mit einer eindeutigen ID erfaßt. |
|
2 |
Kennzeichnung der Archivalien mit ID |
Die ID wird auf Label gedruckt und auf den Archivalien fixiert (bzw. auf einer Hülle). |
|
3 |
Scannen der Archivalien |
Das Bild wird mittels Scanner digitalisert. |
|
4 |
Erfassung der digitalen Bilder in der Datenbank |
Die digitalisierten Bilder werden mit den vordefinierten Objekt-IDs verknüpt. |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Archivalien - Scanprozeß
Vorteil dieses Vorgangs ist, daß es zu keinen Verwechslungen der Dokumente kommen kann (bspw. bei der Auslagerung des Scanprozesses).
Zur Kontrolle von Eingabefehlern sollten insbesondere für automatische oder –semiautomatische Erfassungsprozesse geeignete Werkzeuge angeboten werden. Bei großen Datenmengen sollte dies über Korrelationsprozesse möglich sein.
2.1.11. CIT-Archiv: System-Funktionen
Die nachfolgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der CIT-Archiv Systemfunktionen:
|
System-Funktionen |
Beschreibung |
|
Erfassung von Objekten |
Die Ojekttypen müssen im System abbildbar sein. |
|
Reminder-Funktion |
Reminderfunktion zur Überwachung von Ablaufdaten/Sanierungsanforderungen von Archivalien/Microfiches bzw. von digitalen Datenträgern |
|
Export-Funktion |
Die Daten müssen über Standard-Schnittstellen wie auch direkt auf CD exportierbar sein. |
|
Printout |
Die Daten müssen automatisiert mit Fotodrucker, Farbdrucker etc. ausgefertigt werden können bzw. in entsprechenden Präsenationsformen exportiert werden können. |
|
Listenerstellung und Bearbeitung |
Archiv-Abfragen und Abfrage–Ergebnisse müssen zu Dokumentations- und Präsentationszwecken exportiert und aufbereitet werden können. |
|
Planarchiv / historische Layer |
Historische Zustände und Entwicklungen sollen nach Voreinstellungen wiederholt abrufbar sein. |
|
Einfache Recherchemöglichkeit und Auswertung (Ausdruck/Ausgabemöglichkeit) |
Einfacher Zugang, auch in Hinblick auf die Vorbereitung und Erstellung von Publikationen (Die Erstellung eines Vortrages auf Grundlage div. Archivbilder und Datenauswertunge, z.B. mittels Powerpoint, soll komfortabel möglich sein.) |
|
Bearbeitungsmasken / -filter fachthematische Layer |
Bearbeitungsmasken und fachthematische Layer sollen für verschiedene Nutzergruppen verfügbar sein, z.B. für den Restaurator, Kunsthistoriker, Archäologen, die Sicherheitstechnik, etc. |
|
Relationen erstellen |
Erstellung von Relationen zwischen den Objekten (Mit gewählten Textdokumenten werden Bilder verknüpfbar sein.) |
|
Orientierungsystem |
Die eingepflegten Objekte werden mit der Gliederungsstruktur verknüpft; eine Suche in der Gliederungsstruktur zeigt zugehörige Objekte. |
|
Webzugang |
Die Archivbestände müssen über Web zugänglich sein, bzw. über Datenexports auf eine Website exportiert werden können. |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: System-Funktionen
2.1.12 . CIT-Archiv: Zugriffsrechte
Der Zugriff auf die Datenbestände erfolgt auf mehreren Ebenen:
|
Zugriffsebene |
Zugriffsrecht |
|
System-Ebene, |
Der Nutzer meldet sich am System mit der Benutzerrolle, bzw. als User mit Gruppenzugehörigkeit zu einer Benutzerrolle am System an. Das Profil dieser Rolle definiert Zugriffsrechte und Voreinstellungen am System. |
|
File-System-Ebene |
Den einzelnen Rollen sind verschiedene
Zugriffrechte im Programm bzw. auf File-Systemebene zugeteilt. Dadurch
kann der Nutzer auf relevante Objekte zugreifen, andere bleiben verborgen. |
|
Internet-Zugang |
Der Zugang wird über verschiedene IN-Server-Services kontrolliert. |
|
Extranet |
Für bestimmte Expertengruppen kann
ein Extranet eingesetzt werden; |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Zugriffsebenen und Zugriffsrechte
Weitere Zugriffe, insbesondere unberechtigte Zugriffe über das Internet sind durch eine Firewall zu verhindern.Neben den üblichen administrativen Tätigkeiten (Installation, Updates, Diskspace bereitstellen, LogFiles-Auswertung) sind folgende Funktionen für eine zuverlässige Datenhaltung zu berücksichtigen:
|
Funktion |
Beschreibung |
|
Nutzerrechtezuteilung |
Im Umgang mit Rechteverteilungen ist besondere Sorgsamkeit erforderlich. Nur dadurch ist es möglich, Benutzer vor unsachgemäßer Handhabung zu bewahren. Schulung auf die Rechtezuteilung ist durchzuführen. |
|
Passwörter |
Administratorpaßwörter sind nur autorisierten Personen zugänglich und sollten regelmäßig geändert werden. Aufzeichnungen über Paßwörter sollten sorgsam verwahrt werden. |
|
Backup |
Nur eine praktizierte Backupstrategie kann sinnvoll vor Datenausfällen schützen. Demzufolge sollte damit sofort nach Inbetriebnahme des Systems begonnen werden. |
|
Serverausfall |
Neben einer praktizierten Backupstrategie muß eine Ausfallsstrategie erarbeitet werden, die bei der Auffindung von Fehlerquellen behilflich ist, ... |
|
Datenausfall |
... bzw. für die Rückführung bei allfälligen Datenausfällen verantwortlich ist. |
|
Systemzugriffe |
Zugriffe auf das System werden in
Log-Files dokumentiert; |
|
Datensicherheit / Systemsicherheit |
Ein Datensicherheitskonzept ist zu erstellen, um Daten vor Verlusten oder Verfälschungen zu schützen; aber auch Datensicherheit hinsichtlich Personaldaten ist zu gewährleisten. |
|
LogFiles |
Log-Files dokumentieren den Betrieb
des Systems; |
|
Virenschutz |
Auf dem Arbeitssystem/Erfassungs- und Kommunikationssystem sollte ein Virenschutz installiert sein, sowie entsprechend Updates regelmäßig durchgeführt werden. |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Funktionen für zuverlässige Datenhaltung
Service und Wartungsverträge zur Software sind mit den Herstellern auszuarbeiten. In den Service-Verträgen sind meist Software-Updates und Hotline enthalten. Software-Erweiterungen sollten optional angeboten werden.
Weiters ist Support durch Newsgroups, Konferenzen, Usermeetings und OpenSource-Groups zu berücksichtigen.
2.2. CIT-Archiv: Software-Lösungen
Die Palette an Software-Lösungen für den Archiv- bzw. Museumsberiche ist weitreichend. Die Marketingmaterialien der Anbieter versprechen nahezu jede Möglichkeit:
In Cathedral.IT sollte deshalb besonders auf bestehende Software-Lösungen bei Projektpartnern (Passau, Regensburg, ..) Rücksicht genommen werden, weil hier bereits über Erfahrungspotiential im Einsatz von Archiv-Lösungen für Dombauhütten verfügt wird. Weiters werden Archivalien zwischen anderen Einrichtungen (Historisches Museum der Stadt Wien bzw. wissenschaftlichen Einrichtungen) ausgetauscht bzw. verknüpft. Deshalb wurden auch die in diesen Einrichtungen existierenden Lösungen untersucht.
Zielsetzung ist eine Auswahl eines Archiv-System für die Dombauhütte, das möglichst den individuellen Anforderungen der Dombauhütte entspricht. Das System soll den technischen, finanziellen und organisatorischen Kapazitäten der Dombauhütte angepaßt sein. Die in Cathedral.IT geplanten Komponenten der Schadenskartierung müssen mit dem System verzahnt werden können.
2.2.3. Marktüberblick / Produkt-Auswahl
Die am Markt angebotenen Lösungen für Archive lassen sich grob in 3 Gruppen teilen:
|
Kategorie |
Beschreibung |
|
1. |
Kostengünstige Standardlösungen mit geringem Adaptierungs- und Einarbeitungsaufwand. Der Einsatz des Werkzeugs richtet sich nach den technischen Möglichkeiten des Programms. |
|
2. |
Maßgeschneiderte, individuelle Lösungen, die durch eigene oder externe EDV-Einrichtungen ausprogrammiert werden. Die Lösungen sind häufig Unikate. |
|
3. |
Spezifische, handelsübliche Archiv-Lösungen, die an die Anforderungen des Benutzers angepaßt werden. Hier gibt es weitere Unterscheidungen, in wie weit der Benutzer selber Anpassungen am Programm vornehmen kann. |
Tab. 2-x: Cathedral.IT-Archiv: Kategorisierung von Softwarelösungen für Archive
Die Lösungen gliedern sich meist in Module, die je nach Anforderung der Archiv-Lösung bzw. Art der Einrichtung kombiniert werden können. So besteht bspw. in allen hier untersuchten Programmen ein Scanner-Modul zu Einarbeitung der Archivalien. Spezifische Archiv-Lösungen bieten komplexe Objekttypen und Verknüpfungen an, wenn Archivalien für wissenschaftliche Aufgaben verwendet werden. Chronologische Funktionen werden zur Erinnerung im Verleih bzw. zur Zustandserhaltung von Archivalien angeboten.
Die Angepaßtheit der Software an den Benutzer entscheidet über Arbeitsaufwand und Datenqualität.
Die Etablierung von Software-Applikationen am Markt kann durch 3 Formen erreicht werden:
Nach den schon eingangs erwähnten Kriterien wurden insbesondere die bei Projektpartnern und mit der Dombauhütte zusammenarbeitenden Einrichtungen eingesetzten Lösungen untersucht. Dabei wurde die Auswahl auf die nachfolgenden 4 Lösungen eingegrenzt:
|
Produktname |
Hersteller |
Webadresse |
|
Apollo Bilddatenbank |
Apollo Digitale Bearbeitungs GmbH Wien |
|
|
Artefact |
CMB Wien |
|
|
DocuWare |
DocuWare AG |
|
|
HIDA |
startext
GmbH |
Tab. 2-x: Cathedral.IT: Untersuchte Archivlösungen
Ein Liste an weiteren Software-Lösungen ist unter 2.2.6. angeführt.
2.2.4. Beschreibung der Software-Lösungen
Folgend angefuehrte Loesungen wurden fuer den Einsatz
in CIT diskutiert:
Die Auswahl wurde aus Recherchen, Empfehlungen und den Einsatz in Dombauhuette-Verwandten
Einrichtungen vorgenommen.
2.2.4.1. Apollo Media Asset Management Systeme
Produkt: Apollo Media Asset Management System
http://www.apollo-imaging.com/german/html/products/index.html
Hersteller: Apollo
http://www.apollo-imaging.com
Kurzbeschreibung:
Apollo zählt zur Kategorie 3 der unter 2.2.3 beschriebenen
Gliederung an Applikationen und bildet somit ein Basis-System, welches für den
Kunden angepaßt wird.
Apollo Media Asset Management System besteht aus modular aufgebauten Komponenten
basierend auf Oracle (OS-Komponenten: SUN, SGI, Intel).
Die Komponenten sind
System-Manager: Der System-Manager ist eine lokale Windows-Applikation.
Im System-Manger befinden sich Konfigurationtools wie Media-Manger, und Mars-Konfigurator,
zu Voreinstellungen und Konfiguration von Bild-, Video- und Dokumententypen
sowie Import- und Exportspezifikationen.
User-Manager: Einrichtung von Benutzern und Benutzergruppen.
Definition der vergebenen Zugriffsrechte.
Netzadmin: Zur Strukturierung der Referenzierungen
Docadmin: Dokumentendefinition
Typadmin: Strukturdefinition
Die Funktionalitäten bilden sich aus einem Betreiber-/Benutzermodell
(bspw. Bildagentur, Vertrieb von digitalen Bildern).
Der Einsatz der Lösung reicht von der Produktion bis zum Archiv und wird dem
jeweiligen Einsatzbereich angepaßt.
Die Suche erfolgt über einen Thesaurus (Themen und Schlagworte), welcher über
einen Thesaurus-Manager gewartet wird.
Abfragen erfolgen über M/@/R/S und sind auch über Internet möglich.
Ein Multimedia-Modul ist verfügbar.
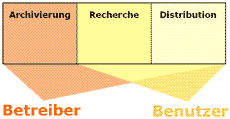
Abb. 2-x: Apollo Benutzer-Betreibermodell
Module/Komponenten/Features:
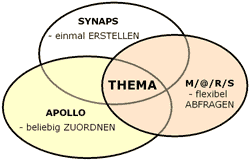
Abb. 2-x: Apollo Komponenten
Apollo
Media-Manager
Synaps: Thesaurus-Manager
M/@/R/S: Archive Retrival System
(http://www.apollomedia.cc/german/html/products/index.html)
Präsentation:
Die Präsentation der Lösung ist direkt beim Hersteller erfolgt.
Referenzen:
DaimlerChrysler AG, Stuttgart
http://www.dcmediaarchiv.com
Verwaltung von historischen Medien (Bilder, Filme, Plakate, ...) - Bestand
ca. 2 Mio Bilder, 700 h Film; Einsatz: Phase I abteilungsintern, nach Einpflege
der "Best of All"-Selektion, Bereitstellung im Intranet.
Otto Versand, Hamburg
Katalogproduktion: Verwaltung von Bildmaterial (Katalog, Alternativbilder) zur
Vereinfachung der Katalogproduktion mit Katalogübernahmen einschließlich weltweitem
Vertrieb des Bildmaterials an Tochterfirmen.
bauMax AG, Wien
http://www.baumax.com/index_flash.htm
Werbeplanung, Verwaltung von Produktdaten (teilw. Übernahme aus WWS), Bildern
und Gestaltungselementen (Produktbilder, Logos, Stimmungsbilder, ...) zur teilautomatisierten
Produktion von Werbemitteln (Kataloge, Flyer, Anzeigen...).
Landesbildstelle Württemberg, Stuttgart
Konservierung des Bildbestandes, Verwaltung des Bildmaterials und der Distribution
samt Kontrolle von Retouren im Sinne klassischer Agenturabläufe.
Nova Photo Graphik Bildagentur, Wien
Bereitstellung von ca. 100.000 Bildern über Kulturpflanzen via Internettechnologie;
Lizenzierung über Partnerunternehmen zur Herstellung von POS-Material, Samensäckchen
etc. mit Urheberrechtverwaltung sowie mit voll integrierter Logistik.
TU-Wien, Institut für Raumgestaltung und Entwerfen
Multimedia-Datenbank für die Lehre.
Links über Apollo:
Daimler-Archiv
http://www.dcmediaarchiv.com
BauMax
http://www.baumax.com/index_flash.html
Bilddatenbankvergleich
http://www.profifoto.de/artikel/bilderbanking/bilddatenbanken.html
Produkt: Artefact
http://www.e-archive.it
Hersteller: CMB Informationslogistic GmbH / archiv.it, Wien
http://www.cmb.at
Kurzbeschreibung:
Artefact fällt in die oben beschriebene Software-Kategorie 3.
Artefact ist eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Produktes „Storager“,
welches seit 1991 am Markt angeboten wird. Ein Beschreibung dazu ist im Software-Vergleichs-Bereicht
des Deutschen Museumsbundes zu finden.
Artefact ist ein Sammlungs-Management-Programm zur Verwaltung von Museums- oder
Sammlungsbeständen.
Das Programm basiert auf einer relationalen Datenbank (Oracle/MS-SQL-Server)
und bietet eine hohe Flexibilität in der Erstellung von Relationen. Die Anpassung
der Applikationen wird über Parametrisierung durch CMB durchgeführt. Dies erfolgt
auf der Basis von Modulen oder „Datenarten“ und zugehörigen Funktionen sowie
einstellbare Masken.
Datenarten sind Objekte, Personen, Bilder, Ereignisse, Dokumente, Archivalien,
Akten, und AV-Medien.
Das Programm bietet Module für Leihvorgänge, e-Commerce-Anbindung, Webpublishing,
Verpackungsmaterialverwaltung u.a.
Die Ein-/Ausgabe erfolgt über benutzerbezogene, einstellbare Listen, Formblätter
bzw. entsprechende Fenstereinstellungen (z.b. Leuchtpult); Sucheneinstellungen
können gespeichert werden. Eine Group-Editing-Funktion dient der Bearbeitung
mehrerer Datensätze.
Zum Import von „Massen-Daten“ - wie Thesauri oder Bilder - existieren einfache
Funktionen zur Verknüpfung oder Umstrukturierung.
Relationen können unter Berücksichtigung einer Benutzerberechtigung zwischen
Datenarten und Datensätzen generiert werden. Die Relationen werden bei Selektion
der Daten dargestellt.
Suchemöglichkeiten sind Volltext bzw. spezifisch über eine hierarchische oder
alphabetische Struktur eines Thesaurus. Einschränkungen auf die Verfolgung verknüpfter
Daten sind möglich. Das Suchergebnis wird in einer Ergebnisliste dargestellt.
Beim Bildimport werden automatisch Bilder in unterschiedlichen Qualitäten und
Größen erstellt. Textanmerkungen, also digitale Wasserzeichen
(z.B. © Vermerk) können automatisch in das Bild eingefügt werden.
Die Detailansicht aus der Dateiliste zeigt die Metainformation
des Bildes: Auflösung, Verknüpfungen zu anderen Datensätzen, Erfassungsinformation
und ursprüngliche Information des Bildes.
Ausdrucke werden über das "Reporting System" erstellt. So können Findbücher,
Karteikarten, Leihverträge u.v.m. mit beliebigen Inhalten erstellt werden. Auch
für Publikationen wird die Funktion Ausdrucke verwendet.
Das Workflow-Management in Artefact organisiert Arbeitsabläufe wie Leihe oder
Arbeitsroutinen über Arbeitsmappen.
Multilingualität weist sich in Artefact besonders durch „on-the-fly“-Umschalte-
und Erfassungsmöglichkeit aus. Sprachausführungen sind
Deutsch, Englisch und Italienisch. In Vorbereitung sind Russisch, Französisch
und Spanisch.
Zur Datensicherheit werden in Artefact entsprechende Benutzerzugriffsrechte,
Logbuch über Zugriff- und Modifikationsprozesse, sowie im Hard-/Softwarebereich
eine Firewall eingesetzt.
Präsentation
Der Artefact-Präsentationstermin fand bei der Firma CMB statt.
Die Evaluierung seitens CMB wurde Vorort am Dombauamt durchgeführt.
Vorführungen / Erfahrungsbericht HMW
Bericht Franz Zehetner:
Vorführung Artefact im HMW, Mag. Walter Öhlinger, DI Franz Zehetner - 17.4.2001,
13:15-14:45
Installation im HMW:
dzt. ca. 10.000 Objekte und ca. 5.500 Personen erfaßt; Thesaurus von
Zettelkatalog-Systematik übernommen; Gruppen, Techniken etc. (Auswählen der
Eingabemasken) von Albertina im Zuge eines „Updates“ (?) übernommen. Albertina
verwendet Artefact aber nicht mehr (lt.W.Öhlinger); Bedienung durch unterschiedliche
Personen, wobei anscheinend nicht alle (bzw. nur wenige) Möglichkeiten des Programmes
ausgeschöpft werden. Anwendererfahrungen sind trotzdem wertvoll; gleiche Installation
in Kupferstichkabinett der Akademie d. bildenden Künste (Werkvertrags-Unternehmerin
arbeitet an beiden Systemen, dazu Pohanka, Öhlinger, etc. ).
Probleme und offene Fragen:
„Vermurkster“ Thesaurus
Kein Fehler von Artefact, weil (fehlerhaft) von Zettelkatalog-Systematik
übernommen – ist aber ein Faktum und kann auch in anderen Installationen vorkommen;
zur Problemlösung bietet Artefakt zwar Wartungstools für Thesaurus an; aber
bei Verschiebung von Begriffen zu anderen Überbegriffen gehen Verknüpfungen
verloren? Fehlbedienung oder Programmschwäche? wenn letzteres, dann Frage, ob
behebbar?
Eingabemasken - Auswahllisten
Übernommen von Albertina (?); müßten natürlich neu formuliert werden; nicht
kontextsensitiv, bei Skulptur ist z.B. Technik „Aquarell“ auswählbar? korrigierbar?
mit welchem Aufwand? Bei Unvollständigkeit oder neuen Anforderungen: besteht
Pflegemöglichkeit der Auswahl-Listen für „superuser“?
Nicht beobachtete, lt.W.Öhlinger berichtete
Probleme:
Probleme bei Übernahme vom vorherigen Datensatz: tw. werden Verknüpfungen (Assoziationen)
nicht übernommen; Thesaurus-Einträge bei Objekt erscheinen manchmal nicht. -
bekanntes Problem? Hardwarefehler?
Referenzen:
Referenzprojekte sind:
BMW-München, Bildarchiv
http://www.historischesarchiv.bmw.de/hias/
Historisches Museum Wien,
Dr. Pohanka, Karlsplatz, A-1040 Wien, Tel. 00431-5058747
Graphische Sammlung Albertina, Dr. Benedik, Albertinaplatz, A-1040 Wien, Tel.
00431-534830
Museumsdorf Cloppenburg, Dr. Meiners, Bether Str. 6, D-49661 Cloppenburg,
Tel. 04471-94840
Landesmuseum Emden, Dr. Scheele, Rathaus, D-26721 Emden, Tel. 04921-22855
Sammlung Essl, Klosterneuburg
Artothek, Bundeskanzleramt, Dr. Pichler, A-1010 Wien
Museum Moderner Kunst, Dr. Lachnit, Arsenalstr. 1, A-1030 Wien
Kupferstichkabinett, Dr. Knofler, Akademiehof, A-1010 Wien
Portfolio Kunst AB, Dr. Eisl, Mirthgasse 109, A-1190 Wien
u.a.
Links:
Software-Vergleich, Museumsdokumentation 1998 -
Ein Bericht der Arbeitsgruppe
Software-Vergleich in der Fachgruppe
Dokumentation beim Deutschen Museumsbund
http://www.museumsbund.de/fgdoku/ag-softwarevergleich/Test_DMB1.html
BMW-Bildarchiv
http://www.historischesarchiv.bmw.de/hias/
Datenbanken und Museumsarchiv-Lösungen
http://www.geocities.com/Tokyo/Towers/8189/databases.html
Produkt: DocuWare
http://www.docuware.de/
Hersteller: DocuWare AG, Germering bei München - Deutschland
http://www.docuware.de/
Kurzbeschreibung:
DocuWare liegt heute in Version 4.1 vor und ist der Kategorie 1, also kostengünstige
Standardlösungen mit geringem Adaptierungs- und Einarbeitungsaufwand zuzuordnen.
DocuWare AG ist seit 1988 am Markt. Aus einer Entwicklung für PC-Karten
für Scanneransteuerung über Bildkompression und Archivierung hat sich die DocuWare-Produktlinie
herausgebildet. Die Software wird zum Erfassen, Indizieren, Versenden, Anzeigen
und Drucken von Dokumenten aller Art eingesetzt.
Ein Vielzahl an Modulen sind für DocuWare verfügbar:
Importfunktionen, Schrifterkennung (OCR), CD-Service zur Archivierung, Integration
in LotusNotes bzw. Anbindung an SAP, Server-Client-Ausführungen.
Eine detaillierte Beschreibung von DocuWare ist der Produktpräsentation
http://www.docuware.de/1_produkte/produkte/index.cfm
zu entnehmen.
Präsentation:
DocuWare wird bei der Dombauhütte in Regensburg eingesetzt und demonstriert.
Der Einsatzschwerpunkt der Archiv-Lösung ist stark auf die Bildmaterialien fokusiert.
Referenzen:
Von DocuWare existieren 4.500 Installationen in 10 verschiedenen Sprachen.
Das Produkt wird lt. Refenenzliste in den Bereichen Industrie, Banken, Versicherungen
und Servicebereich eingesetzt.
Links:
BAK-Informatik Berlin
http://bak-information.ub.tu-berlin.de/software/arch.html
![]()
Produkt: HIDA
http://startext.de/HIDA3
Hersteller: startext GmbH, (Bonn)
http://www.startext.de
Kurzbeschreibung:
HIDA gehört zur oben genanten Kategorie 3 der Software-Lösungen.
HIDA (Hierarchischer Dokumentadministrator) gibt es seit 1988 und ist dzt.
in der Version 3 Release 2 in 75 Institutionen im Einsatz.
HIDA ist eine Kombination aus einer relationalen und einer hierarchischen Datenbank.
HIDA wird mit verschiedenen Datenfeldkatalogen ausgestattet.
Eine kundenspezifische Anpassung wird von startext GmbH durchgeführt.
Programmschwerpunkte sind die Inventarisierung und Katalogisierung in Museen,
Archiven und Bibliotheken. Zu den Bereichen gehören Daten erfassen, verwalten,
finden; Material-, Inventur-, Bestandslisten, Inventarkarten drucken; wissenschaftliche
Pulbikationen vorbereiten und Austausch mit anderen Institutionen.
Zielgruppen sind zum einen umfangreiche Bildsammlungen, zum anderen kleine und
mittlere Museen. HIDA ist darauf ausgerichtet, die wissenschaftliche Katalogisierung
in aller Differenziertheit zu unterstützen und dabei die Nutzung von Normdaten
zu erleichtern.
Ein Beschreibung ist unter:
Software-Vergleich Museumsdokumentation 1998
Ein Bericht der Arbeitsgruppe Software-Vergleich
in der Fachgruppe Dokumentation
beim Deutschen Museumsbund
http://www.startext.de/hida/hida3/softvergl1.htm
zu finden.
Präsentation:
HIDA wird an der Dombauhütte Passau verwendet und demonstriert.
Referenzen:
Bildarchiv Foto Marburg
http://fotomr.uni-marburg.de/
Landesstelle für die
Nichtstaatlichen Museen in Bayern
http://www.museen-in-bayern.de/
Sächsische Landesstelle
für Museumswesen
http://museen-in-sachsen.smwk.de/
Albert-Ludwigs-Universitaet-Freiburg
http://www.uni-freiburg.de/
KUB - Kunsthaus Bregenz
http://www.kunsthaus-bregenz.at/
Germanisches Nationalmuseum
http://www.bn.shuttle.de/aski/gnm.htm
Spielzeugmuseum
Nürnberg
http://www.nuernberg.de/ver/him/sp/index.htm
Museen der
Stadt Nuernberg - Graphische Sammlung
http://www.nuernberg.de/ver/him/gr_d.htm
Historisches Museum
Basel
http://www.unibas.ch/museum/d/hmb.htm
Institut für Kunstgeschichte
Insbruck
http://info.uibk.ac.at/c/c6/c618/
Museum Bayerisches
Vogtland
http://www.hof.de/museum/bayvl_mu.htm
Museen in
Köln - Museum für Ostasiatische Kunst
http://www.museenkoeln.de/mok/index.html
Österreichische
Nationalbibliothek
http://www.nhm-wien.ac.at/bundesmuseen/ONB/MAIN.HTM
Schlossmuseum
Murnau
http://www.lrz-muenchen.de/~kl921aa/WWW/index.html
Museen in
Köln - Wallraf-Richartz-Museum - Das Museum
http://www.museenkoeln.de/wrm/index.html
Museum für Kunst und Gewerbe
Hamburg
http://www.mkg-hamburg.de/
Links
Literatur zu HIDA
http://www.startext.de/hida/h3referenz.htm#literatur
Software-Vergleich
http://www.startext.de/hida/hida3/softvergl1.htm
Produkt: IMDAS
http://www.imdas.at
Hersteller:
Johanneum Research
Graz
http://iis.joanneum.at/
Referenz:
Kunsthistorisches Museum
Münzkabinett
http://www.khm.at
IMDAS-Pro wird verwendet
a) zur Erfassung des Bestandes im Inventar (rund 700.000 Objekte sind zu erfassen),
damit verbunden zur Erstellung von Bestandskatalogen und als Unterstützung für
die Objektbeschreibung bei Ausstellungskatalogen;
b) zur Aufnahme der Fundmünzen (Antike, Mittelalter, Neuzeit) aus Österreich
und Erstellung einer Publikation derselben.
Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart
D-70191 Stuttgart
http://www.naturkundemuseum-bw.de
Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim
D-68165 Mannheim
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
D-70029 Stuttgart
http://www.mwk-bw.de
2.2.4.6.
Andere Archiv-Software-Lösungen von
lokalen Anbietern:
Produkt: M-BOX
http://www.mbox.at
Hersteller:
daten unlimited
Schwaz / Tirol
http://www.mbox.at
Präsentation:
MBox wurde an der Dombauhütte demonstriert.
Referenz:
Swarovski Tirol
Porsche
2.2.4.7. Andere Archiv-Software-Lösungen von lokalen Anbietern
http://snake.cs.tu-berlin.de:8081/~bak/software/museum.html
Auflistung von Archiv-Software-Lösungen des Deutschen Museumbundes:
http://www.museumsbund.de/fgdoku/ag-softwarevergleich/adressen-Anbieter-2000-11-28.html
Museum.hlp: Auflistung von Verbänden und Institutionen, Europäischer Zusammenarbeit,
Inventarisierung und Dokumentationen –Standards, Regelwerke, Software:
http://home.t-online.de/home/Bulle/pinnwand.htm
Linksammlungen von Archiv-Software-Lösungen:
http://www.geocities.com/Tokyo/Towers/8189/databases.html
Die angeführten Lösungenentsprechen mit Ausnahme von Dokuware alle der
oben beschriebenen Kategorie 3, sind also Standard-Bildarchiv-Lösungen, die
den Nutzerbedürfnissen angepasst werden.
Im wesentlichen bieten alle beschriebenen Produkte die erforderlichen Grundfunktionen
wie:
• Import von Bildmaterialen (Workflow von Scannen bis Einpflege der Daten),
• "Leuchtpult" zur graphischen Auswahl und Bearbeitung von Bildmaterialien,
• Thesaurus,
• relationale Verknüpfungsmöglichkeit der gespeicherten Daten,
• verschiedener Datentypen,
• Suchmoeglichkeiten,
• Reporterstellung,
• Export der Bildmaterialine,
• Webanbindung
Je nach Hersteller sind die angeführten Funktionen in den Applikationen
unterschiedlich starkt ausgepraegt.
Die meisten Anbieter unterstuetzen den Prozess der automatischen Generierung
von mehreren Bildaufloesungen aus den gescannten Bildmaterialien, bzw. die automatische
Ergaenzung von Urheberkennzeichnungen. Der Workflow der Bilderfassung kann bei
wenigen Anbietern frei definiert werden. Auch der Datenimport via XML wird nicht
von allen Anbietern unterstuetzt.
Hybride Methoden zur Verwaltung der Originale sind in allen angefuehrten Applikationen
enthalten.
Umfassende Datenarten wie, Objekte, Personen, Bilder, Ereignisse, Dokumente,
Archivalien, Akten, und AV-Medien, werden nur von einigen Anbietern unterstuetzt.
Relationen zwischen den Datenarten sind nicht in allen System beliebig moeglich.
Masken und Darstellungen und Listen sind zwischen den Applikationen unterschiedlich
Aufwendig zu definieren. Suchergebnisse sind in Volltext, Ergebnislisten und
graphischen Darstellung hingegen bietet jeder Anbieter.
Multilingualität ist bei
den Herstellern in unterschiedlicher "Qualitaet" realisiert.
Workflowprozesse fuer Arbeitsroutinen (Leihe) oder E-Commerce sind ja nach Anbieter
unterschiedlich stark in der Applikation ausgepraegt bzw. ueber Zusatzmodule
erhaeltlich.
Der Datenexport bzw. entsprechend Schnittstellen zu den in CIT geplanten BPDM-System
sind bei den Anbietern beschraenkt realisiert.
Die Datensicherheit wird meist durch Firewall-konzept, Userverwaltung auf Windows-
und Datenbankebene, Logfiles und Reports geboten.
Integrationsleistungen werden vom Anbieter direkt durchgefuehrt und werden von
den Anbietern fuer das Projekt CIT mit eher gering Aufwand eingeschaetzt.
2.3. Integrationskonzept von CIT-Archiv in die BPDM-Umgebung
Die abgebildete Version zeigt die CIT-Archiv Integration in die BPDM-Umgebung
am Beispiel von Artefact:
Die Kartierungsdaten (MS-Access-Files und DWG-Files) werden auf einen vordefinierten
Pfad zwischen den System BPDM und Archiv ausgetauscht. Der Datenimport ins Archiv
erfolgt in Form eines Kontainers, der die
Kartierungsdaten (Bilder, DWG, Daten) zusammengefasst enthaelt.
Katierungsdaten werden in Kontainern verwaltet bzw. ausgetauscht.
Basis des Systems bildet ein Hardware-Server mit Intel-Architektur. Als Betriebsystem wird Windows2000 verwendet.
MS-SQL-Server wird eingesetzt, weil die Zahl an zu bearbeitenden Dokumenten in sinnvoller Relation zu den Software-Lizenzkosten steht.
Artefact ist eine Windows-Applikation und verwendet MS-SQL.
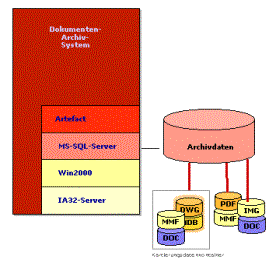
Abb. 2-x: Cathedral.IT: Lösungsvariante Archiv
2.4. Systeminstallations- und Erhaltungsinformationen
2.4.1. Software-Update, -Support, Wartung und Betreung
Der Software-Support wird durch die Software-Anbieter in unterschiedlichen
Formen angeboten.
Die Checklist dient der Erfassung der angebotenen Leistungen:
Support wird Angeboten:
Updates
Newsgroups
Mailingliste
Webseitensupport (FAQ)
Newsletter
Usermeetings
Veranstaltungen
Konferenzen
Software-Änderungsanforderungen müssen über x Jahre angeboten werden.
2.4.2. Infrastrukturelle-Anforderungen
Das Archiv-System wird als Gesamtpaket, bestehend aus Betriebsystem, Datenbank, Archiv-Software vom Anbieter installiert und geliefert.
Betriebsystemvoraussetzungen sind Microsoft-Windows2000.
Lizenzkosten für das Betriebssystem müssen im Gesamtpaket enthalten sein.
Alle zur Archiv-Software gehörigen Kompontenen, sowie alle für den Zugriff für Enduser erforderlichen Komonenten müssen im Gesamtpaket integriert sein.
Beschränkungen für den Zugriff auf das Archiv-System (Zahl an Clients) müssen explizit genannt werden.
Weitere Informationen siehe Infratstrukturkonzept.
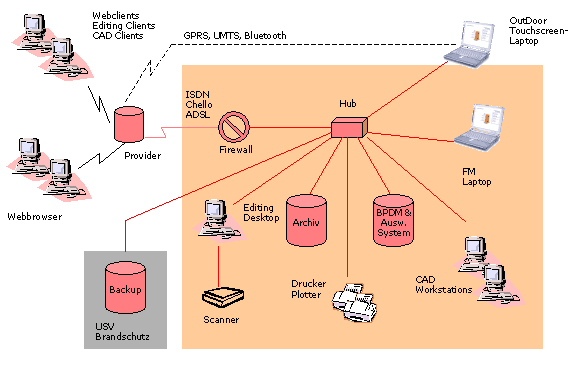
2.4.3. Implementierung, Schulung, Inbetriebnahme, Abnahme
Implementierung
Das Archiv-System wird seitens des Anbieters nach den oben beschriebenen Anforderungen an die Kundenbedürfnisse angepaßt.
Die Implementierung gilt als abgeschlossen, wenn ein vollständiger Testlauf über alle Funktionsbereiche erfolgreich durchgeführt worden ist.
Þ siehe auch Implementierungskonzept
Schulung
Schon während der Implementierung sind die Benutzer in die Produkt-Philosophie und die Implementierungsüberlegungen einzuführen.
Die Schulung ist so durchzuführen, daß die Benutzer in der Lage sind, Daten entsprechend sorgsam und in ausreichender Qualität einzupflegen und zu behandeln.
Der Nutzer muß seinen entstehenden Anforderungen nachkommen können.
Þ siehe auch Schulung
Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme umfaßt neben der Installation und Implementierung auch die Beobachtung des Datenerfassungsprozesses nach der Schulung der Nutzer. Der Aufwand ist mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Þ siehe auch Installation
Abnahme
Ein Abnahmekonzept wird von der Dombauhütte bereitgestellt.
2.5. Ergänzende Informationen zu Archiv-Systemen
2.5.1. Einrichtungen und Verbände
Einrichtungen und Verbände zum Thema Archiv-Software-Lösungen:
Büro für Kulturvermittlung
http://www.austrianmuseums.net/
Cultural Service Centre AUSTRIA
http://www.cscaustria.at/
Museum.hlp: Auflistung von Verbänden und Institutionen, Europäischer Zusammenarbeit,
Inventarisierung und Dokumentationen –Standards, Regelwerke, Software
http://home.t-online.de/home/Bulle/pinnwand.htm
MusIS
— '>Chancen und Probleme großer Dokumentationsprojekte
Jörn Sieglerschmidt, Mannheim
Staatliche Museen in Baden-Württemberg und MusIS
http://www.museumsbund.de/fgdoku/dmbdoku_termine/dmbokt2000/musis/musis1.htm
Die
Virtual Library Museumsseiten Österreich
http://www.naturschau.at/vlmp/vlmp-at-1.html
2.5.1. Standards, Normdaten, Thesauren,
Glossar
Normierungen
British standards,
United States national standards,
http://www.willpower.demon.co.uk/thesbibl.htm#BSI1987
DIN 1463, ISO 2788 und ISO 5964
http://index.bonn.iz-soz.de/~sigel/DGI/KTF
Normdaten
AKL Allgemeines Künstlerlexikon
http://www.saur.de/akl
SWD Schlagwort-Normdaten
GKD Gemeinsame Körperschaftsdatei
PND Personen-Namens-Datei
http://www.ddb.de/professionell/pnd.htm
ICONCLASS Ikonographische Beschreibung
http://www.iconclass.nl/texts/sysfr.htm
SPECTRUM
http://www.mdocassn.demon.co.uk/spectrum.htm
Thesauren
AAT Art & Architecture Tehsaurus
TGN Thesaurus for Geographical Names
ULAN Union List of Artist Names
Software-Produkte für Thesauren
http://www.willpower.demon.co.uk/thessoft.htm
Thesaurus-Management-Software
http://www.fbi.fh-koeln.de/labor/bir/thesauri_new/thsoften.htm
Informationslinguistik
http://www.phil.uni-sb.de/fr/infowiss/papers/iwscript/infoling
Deutscher Museumbund
http://www.museumsbund.de/fgdoku/ag-softwarevergleich/startglossar.html
Anderes
Kunstgeschichte im Netz
http://www.fotomr.uni-marburg.de/adressen.htm
Portale für Museen
http://webmuseen.de/VortragDMB/Start.htm
Museumsliterature Online / ICOM
http://v.hbi-stuttgart.de/museum